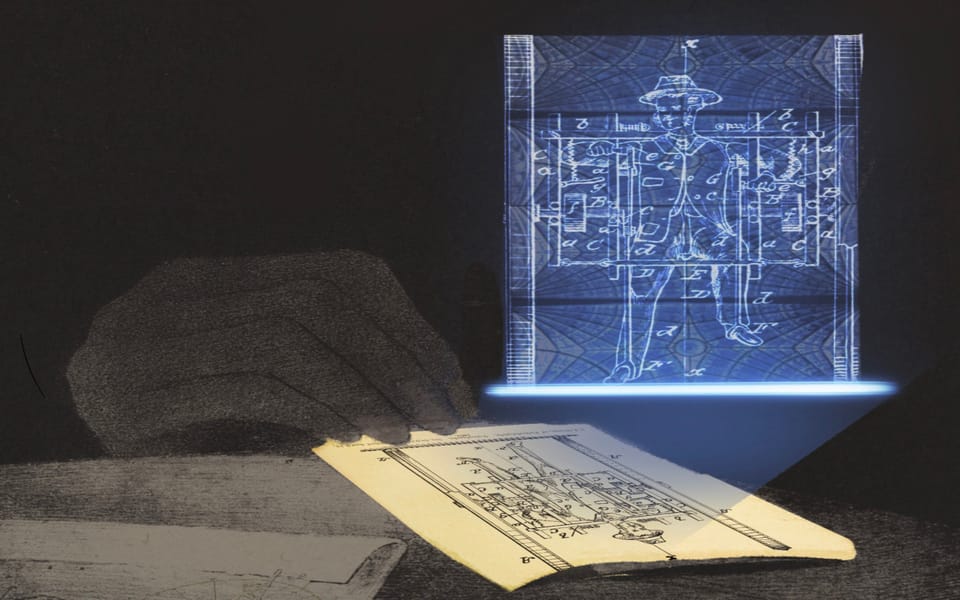Informatik und Gesellschaft
FIfF-Kommunikation 2/2025: Denkende Maschinen - Desinformation - Fediverse - Zivilklausel
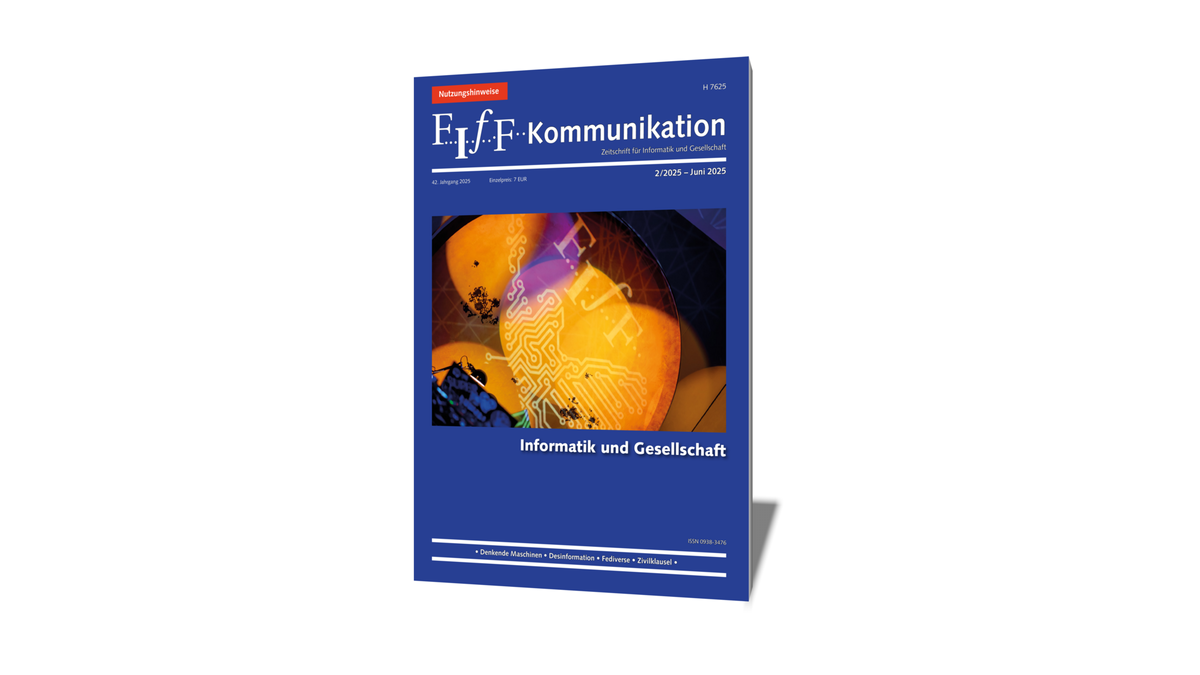
Eine bunte Mischung von Beiträgen aus dem Themenfeld Informatik und Gesellschaft enthält diese Ausgabe der FIfF-Kommunikation. Dabei decken wir Bereiche wie IT-Sicherheit, Friedenspolitik,Künstliche Intelligenz und Öffentlichkeit ab.
Den Anfang macht Maja Warlich mit ihrem Beitrag zu der Spyware FinFisher. Sie untersucht die technischen Details und Produktmerkmale bis hin zu den Auswirkungen auf die Menschen undBürgerrechte. Sie stellt fest, dass die Möglichkeiten der Software, in private Bereiche einzudringen, mit grundlegenden Prinzipien der Menschenrechte im Widerspruch stehen.
Die beiden folgenden Beiträge widmen sich der Künstlichen Intelligenz. Maurice Haugk weist auf die Bedeutung des AI Act der Europäischen Union hin und geht auf Chancen und Risiken der KI ein. Hans-Jörg Kreowski geht der Frage nach, ob die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz zu denkenden Maschinen, also zu einer Künstlichen Allgemeinen Intelligenz führen wird. Er stellt dazu natürliches Denken dem maschinellen Denken gegenüber. Es sei unwahrscheinlich, dass ein superintelligenter, „denkender“ Computer gebaut werden kann, die Möglichkeit aber nicht völlig auszuschließen.
Unter dem Pseudonym three monkeys awoken wird in einem sehr pointierten Manifest die menschgemachte Produktivkraftentwicklung im Zeitalter Künstlicher Intelligenz untersucht. Genannt werden vier Mindestbedingungen zur Verwirklichung einer menschlichen Zukunft: radikale Transformation der Produktionsverhältnisse, globale Kooperation und gerechte Verteilung,gesellschaftliche Kontrolle der Technologien und Ethik und Sicherheit in der KI-Entwicklung. Die planetare Zerstörung, Kriegshetze, Verhetzung und Verrohung muss aufgehalten und eine gemeinsame gute Zukunft für die Menschheit aufgebaut werden.
Nicht erst seit den jüngsten Ereignissen in Israel und Gaza steht die Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland ganz oben auf der Tagesordnung. Marie-Theres Tinnefeld behandelt in ihrem Beitrag die Streitfrage Antisemitismus und Wege des Friedens. Klar ist: Jeder Diskriminierung von Jüdinnen und Juden ist eine eindeutige Absage zu erteilen. Doch mit Omri Boehm fragt sie auch: „Soll, muss nicht etwa auch in der Palästinenserfrage das Ideal des Friedens der Ursprung menschlicher Beziehungen, menschlicher Politik und menschlichen Rechts sein?“
„Obwohl sie sicher zur Desinformation beitragen, sind ... nicht die Plattformen die wirkliche Gefahr, sondern es sind häufig Regierungsparteien oder wichtige Oppositionsparteien, die einflussreiche Produzierende von Desinformationen sind“, sagt die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann. „Studien zeigen, dass Desinformationen erst durch die Massenmedien in die Breite getragen werden, weil sie nach wie vor ein Publikum erreichen, dass weit über das der sozialen Medien hinausgeht.“ Desinformation sei ein Symptom des Demokratieverfalls. „In diesem Sinne müssen sich die Qualitätsmedien fragen, welchen Beitrag sie in der Bekämpfung von Desinformation spielen wollen. Ist es tatsächlich sinnvoll, über jedes Stöckchen zu springen, das ihnen populistische Politiker:innen hinhalten?“ Mit politischer Kommunikation in Sozialen Medien und ihren Konsequenzen befasst sich auch das Interview mit Natascha Strobl aus netzpolitik.org in unserer gleichnamigen Rubrik.
„Die Social-Media-Landschaft befindet sich in einem tektonischen Umbruch, seit Elon Musk Twitter übernahm und Donald Trump die USA“, leitet Volker Grassmuck seinen Beitrag zur Governance in offenen Gemeinschaften ein. Das Fediverse sei ein Gegenmittel gegen die Macht populistischer Politiker:innen in Verbindung mit der zentralisierten Nutzung von Medien: „… lokale, überschaubare Gemeinschaften bilden die Grundlage, spannen untereinander diplomatische Netze und wachsen organisch zu einem Fediverse, das mehr ist, als die Summe seiner Teile. Small is Beautiful als Voraussetzung für Bigger is Better.“
Mit den Herausforderungen von Rücküberweisungen durch Migrant:innen befasst sich Alexandra Keiner in ihrem Beitrag. Rücküberweisungen sind kostspielig und werden häufig als „verdächtige“ Transaktionen eingestuft. „Um Rücküberweisungen einfacher und günstiger zu gestalten, müssen sie als politische und soziale Prozesse verstanden werden, die nicht einfach mit digitalen Technologien gelöst werden können.“
Von einer erfreulichen Entwicklung berichtet Christian Heck aus Köln in seinem Beitrag Zivilklausel@KHM: „Während an vielen Universitäten und Hochschulen Zivilklauseln infrage gestelltwerden, hat der Senat der Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) am 19. Dezember 2024 den Beschluss gefasst, diese in der Grundordnung zu verankern.“ Wir gratulieren den Kolleg:innen herzlich zu diesem Erfolg.
Auch diese Ausgabe enthält ausgewählte Beiträge aus netzpolitik.org. Neben dem bereits genannten Interview ist dies unter anderem ein Beitrag zur kürzlich durch das BMI eher verstohlen veröffentlichten Überwachungsgesamtrechnung – ein Thema, dem die FIfF-Kommunikation bereits in der Ausgabe 4/2019 einen Schwerpunkt gewidmet hatte.